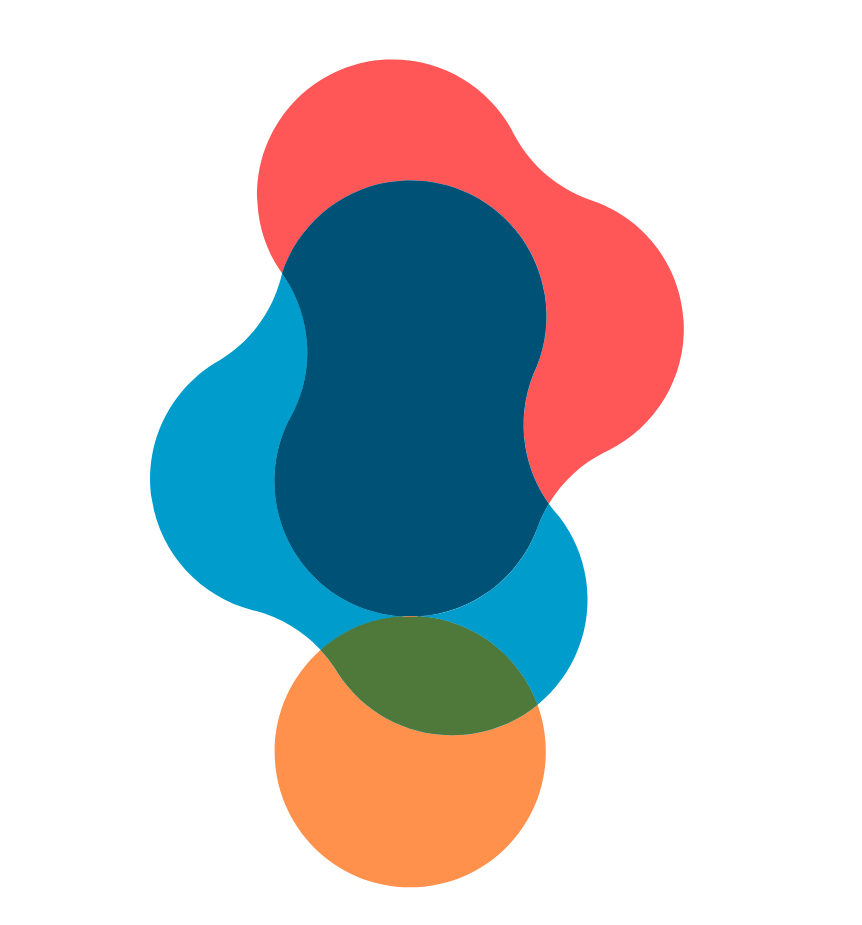Die Berücksichtigung von Geschlechterdimensionen, verstanden als die biologischen, sozialen und kulturellen Dimensionen von Geschlecht, in der medizinischen Forschung verbessert die Qualität, Relevanz, Robustheit und Reproduzierbarkeit von wissenschaftlichen Studien (Heidari et al. 2016). In der Medizin und Gesundheitsforschung kann die Berücksichtigung von Geschlechteraspekten im Forschungsprozess zudem lebensrelevant sein. Die „Gender und Diversity Data Gap “[1] führt dabei zu einer weniger qualitativ hochwertigen und evidenzbasierten Versorgung insbesondere von Frauen und genderdiversen Menschen (Regensteiner et al. 2025; Haupt et al. 2024), sowie Schwarzen Menschen, indigenen Menschen und POC (People of Colour) (Mateo und Williams 2021).
Für Einreichungen bei namhaften Journals wie Nature, The Lancet und Cell, aber auch für die Antragstellung bei großen Drittmittelgebern wie der DFG, dem BMFTR oder der EU ist es daher erforderlich, Geschlecht und Vielfältigkeitsdimensionen zu berücksichtigen, um die Qualität der Forschungsinhalte, sowie ihre Publikations- und Förderchancen zu erhöhen.
- Die DFG-Empfehlungen zu Geschlechter- und Diversitätsdimensionen in der Forschung betonen die Bedeutung von Sex-, Gender- sowie Diversitäts-Aspekten in wissenschaftlichen Projekten und Projektanträgen. Forschende werden dazu aufgefordert, diese Dimensionen systematisch in ihre Fragestellungen, Methoden und Analysen zu integrieren, um die wissenschaftliche Qualität und Relevanz ihrer Arbeit zu verbessern. Weitere Informationen finden sich in den DFG-Richtlinien sowie der Checklistezur Relevanz von Geschlechterdimensionen in der eigenen Forschung.
- Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) betont die Bedeutung der Geschlechterdimension in Forschungsfragen und Projekten und hat die Richtlinie „Geschlechteraspekte im Blick“ (GiB) ins Leben gerufen. Diese Initiative zielt darauf ab, geschlechtersensible Ansätze systematisch im gesamten Forschungsprozess und in allen Fachgebieten zu verankern, um die Qualität und Relevanz wissenschaftlicher Ergebnisse zu erhöhen. Die Richtlinie sowie weitere Informationen finden Sie auf der BMFTR-Website sowie auf der Homepage des GiB-Projekts der Universität zu Köln.
- Auch die Europäische Kommission legt großen Wert auf die Integration von Geschlechterdimensionen in der medizinischen Forschung und den Lebenswissenschaften. Im Rahmen von Horizont Europa, dem aktuellen EU-Forschungs- und Innovationsprogramm, ist die Berücksichtigung von Geschlechteraspekten eine zentrale Anforderung, um wissenschaftliche Exzellenz und Chancengleichheit zu fördern (Horizon 2020).
- Bundesministerium für Gesundheit: Das Bundesministerium für Gesundheit stellt ebenfalls eine Checkliste zu Gender Mainstreaming in Forschung und Anträgen bereit.
Der Artikel von Aldin et al. gibt eine Übersicht über die Antragsrichtlinien zur Integration von Geschlechteraspekten bei deutschen Förderinstitutionen im Gesundheitswesen inklusive Stiftungen (Aldin et al. 2020).
[1] Die Gender und Diversity Data Gap – oder geschlechts- und diversitätsbezogene Datenlücke – beschreibt das Fehlen von geschlechts- und diversitätsassoziierten Daten. Sie bezeichnen somit Wissenslücken, welche durch fehlende oder unterrepräsentierte Datenerhebung entstehen. Die Gender Data Gap identifiziert insbesondere Wissenslücken in Bezug auf Frauen und genderdiverse Menschen, die Diversity Data Gap bezeichnet allgemeiner Wissenslücken in bezug auf marginalisierte und unterrepräsentierte Gruppen in der Datenerhebung, wie Schwarze Menschen, indigene Menschen und People of Color (BIPOC), oder Menschen mit Behinderung.