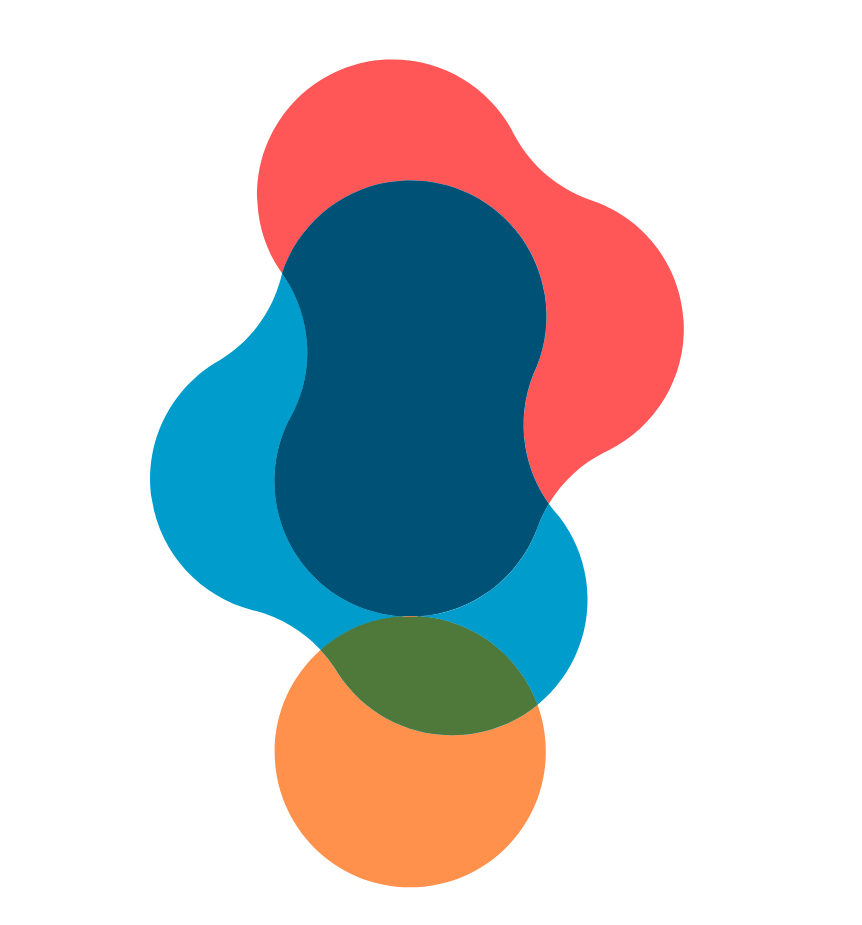Fallbeispiel 1: Formulierung von Forschungsfragen, Analyse und Reporting
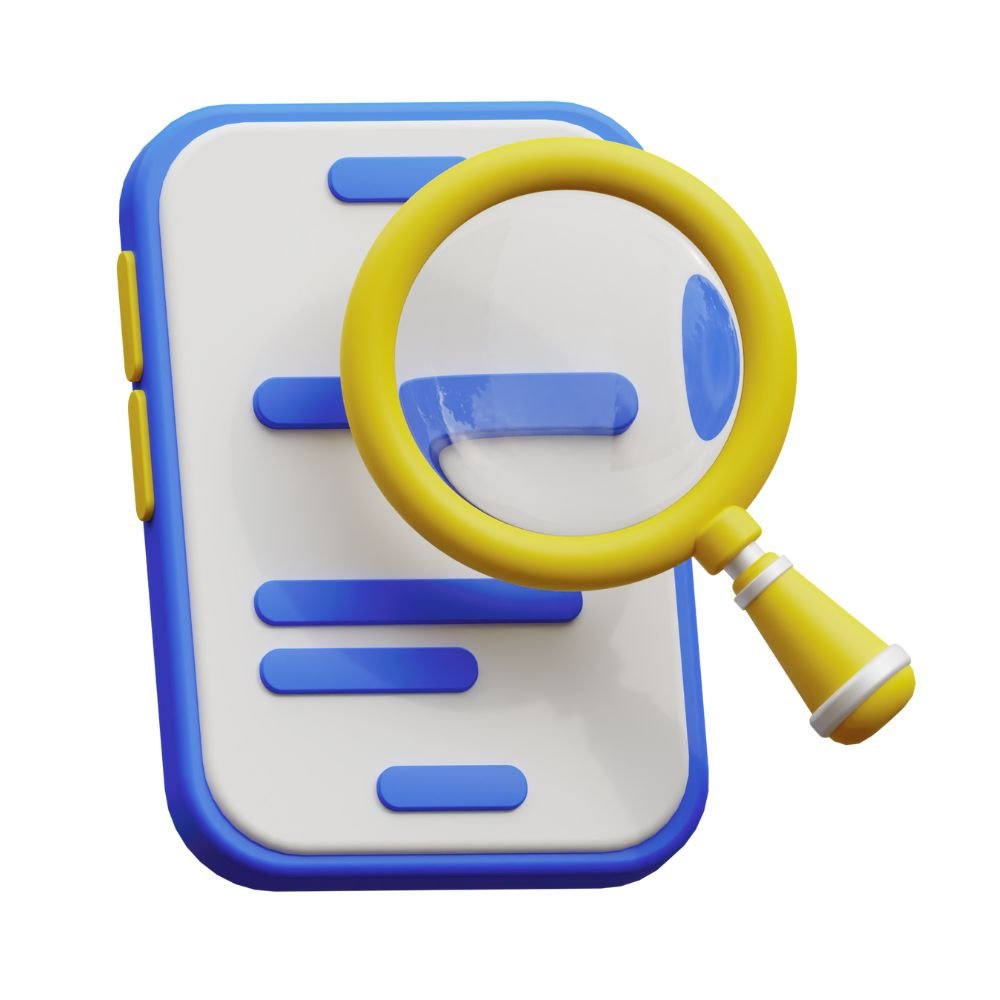
Neben der Rekrutierung von verschiedenen Geschlechtern und Personengruppen, ist die anschließende geschlechterspezifische Analyse und ihr systematische Reporting entscheidend, um diese interpretieren und übertragen zu können. Eine Studie von Brady et al. zeigte jedoch, dass bei klinischen Studien zu COVID-19 Geschlecht nur unzureichend berücksichtigt wurde: nur 4% der registrierten Studien planten einegeschlechtsspezifische Subgruppen-Analyse, und lediglich 17,8% der untersuchten veröffentlichten Randomisierten Kontrollierten Studien (RCTs) berichteten spezifische Ergebnisse (Brady et al. 2021)
So können beispielsweise geschlechtsspezifische Aspekte in Infektionsverläufen, Immunreaktionen und Therapieansprechen unerkannt bleiben, da sie in aggregierten Auswertungen nicht sichtbar werden, und nicht geschlechtsspezifisch berichtet werden.
Fallbeispiel 2: Fallbeispiel Grundlagenforschung mit Gewebe/Zellen

In der Pharmakologie werden durch die fehlende Berücksichtigung von Informationen über das genetische Geschlecht des Gewebes/der Zelle entscheidende Aspekte im Arzneimittelstoffwechsel übersehen. Dies führt dazu, dass Frauen fast doppelt so häufig wie Männer unerwünschte Arzneimittelwirkungen erfahren (Zucker und Prendergast 2020)
. Ein markantes Beispiel ist das Enzym Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4), das eine entscheidende Rolle im Arzneimittelstoffwechsel spielt. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die CYP3A4-Expression und -Aktivität zwischen männlichen und weiblichen Zellen unterschiedlich sein kann, was möglicherweise zu Unterschieden in der Wirksamkeit und Toxizität von Arzneimitteln führt (Gogos et al. 2019)
. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufig eine höhere CYP3A4-Aktivität aufweisen, was zu einem schnelleren Metabolismus bestimmter Medikamente führt. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede werden jedoch bei Laborstudien mit Zellkulturen häufig übersehen, da das genetische Geschlecht der Spenderzellen häufig nicht berücksichtigt wird (Shah et al. 2014)
Fallbeispiel 3:Grundlagenforschung mit Tierstudien

Jahrzehntelang wurden in der Schmerzforschung überwiegend männliche Tiere verwendet, da man davon ausging, dass die Hormonzyklen weiblicher Tiere zu Schwankungen führen, die die Ergebnisse verkomplizieren. Dieser Ansatz ignorierte jedoch entscheidende geschlechtsspezifische Variationen in der Schmerzwahrnehmung und der Reaktion auf Schmerzmedikation. Eine Benchmark-Studie von Sorge et al. (2014) zeigte, dass männliche und weibliche Nagetiere unterschiedliche Immunwege zur Schmerzverarbeitung nutzen. Dies bedeutet, dass Schmerzmedikation, die nur an männlichen Tieren getestet wurden, bei weiblichen Tieren möglicherweise nicht gleichermaßen wirksam sind (Sorge et al. 2014).
Dieser Bias in den Tierstudien zeigt erhebliche klinische Auswirkungen. Zahlreiche Studien zeigen, dass Frauen häufiger an chronischen Schmerzstörungen leiden als Männer und oft anders auf Schmerzbehandlungen ansprechen. Das Versäumnis, weibliche Tiere in präklinische Tierversuchs-Studien einzubeziehen, trug dabei entscheidend zu der fortlaufenden Gender Pain Gap, also der Unterdiagnostik und Unterversorgung von Schmerzen bei Frauen bei.
Fallbeispiel 4:Fallbeispiel klinische Studien

Historisch hat sich die kardiovaskuläre Forschung vorwiegend auf weiße, männliche Probanden konzentriert, was zu einem mangelnden Verständnis für die Manifestation von Herzkrankheiten bei Frauen und gender-diversen Personen sowie Schwarzen und POC führte. Regitz-Zagrosek et al. stellten so in einer Studie fest, dass nur 35% der Teilnehmenden in großen kardiologischen Studien Frauen waren (Regitz-Zagrosek et al. 2016), obwohl Herzkrankheiten die führende Todesursache bei allen Geschlechtern sind (Safiri et al. 2022). Dieses Versäumnis hat zu Miss- und Fehldiagnosen und verzögerten Behandlungen von Frauen mit Herzinfarkten beigetragen, da sich ihre Symptome oft von denen der Männer unterscheiden. So treten bei Frauen eher Symptome wie Übelkeit, Schwindel, Oberbauch- und Rückenschmerzen auf als die stereotypen linksseitigen Brustschmerzen, die als sog. „typische“ Herzinfarktsymptome gelten. Prasanna et al. stellten in einer Studie fest, dass 46% der untersuchten kardiologischen Studien einen Anteil unter 25% von Schwarzen Proband*innen beschrieben, wodurch diese weiterhin unterrepräsentiert sind, und die Data Gap fortführen (Prasanna et al. 2021). Dies ist insbesondere problematisch, da Schwarze Patient*innen eine höhere frühzeitige kardiovaskuläre Mortalität aufweisen.
Fallbeispiel 5:Fallbeispiel Surveyforschung

Bestehende Gender Biases in der Umfrageforschung tragen erheblich zu der Gender Data Gap bei. Ein Beispiel sind die Demographic and Health Surveys (DHS), die weltweit zur Erhebung bevölkerungsbezogener Gesundheitsdaten eingesetzt werden. Während Frauen detailliert zu Familienplanung und reproduktiver Gesundheit befragt werden, erhalten Männer hierzu kaum Fragen – umgekehrt verhält es sich bei Themen wie Rauchen oder Alkoholkonsum (Weber et al. 2021). Diese geschlechtsspezifische Strukturierung der Surveys basiert auf traditionellen Rollenbildern und führt zu unvollständigen Datensätzen und geschlechtsspezifischer Biases (Weber et al. 2019). Dies hat weitreichende Konsequenzen, da Gesundheitsstrategien und politische Maßnahmen auf Basis dieser verzerrten Datengrundlage entwickelt werden und potentiell geschlechtsspezifische Gesundheitsrisiken unzureichend berücksichtigt werden (Shannon et al. 2019).